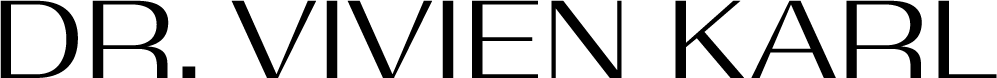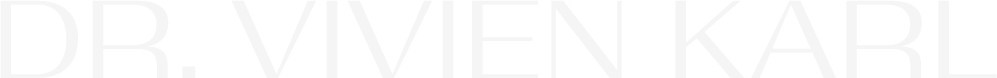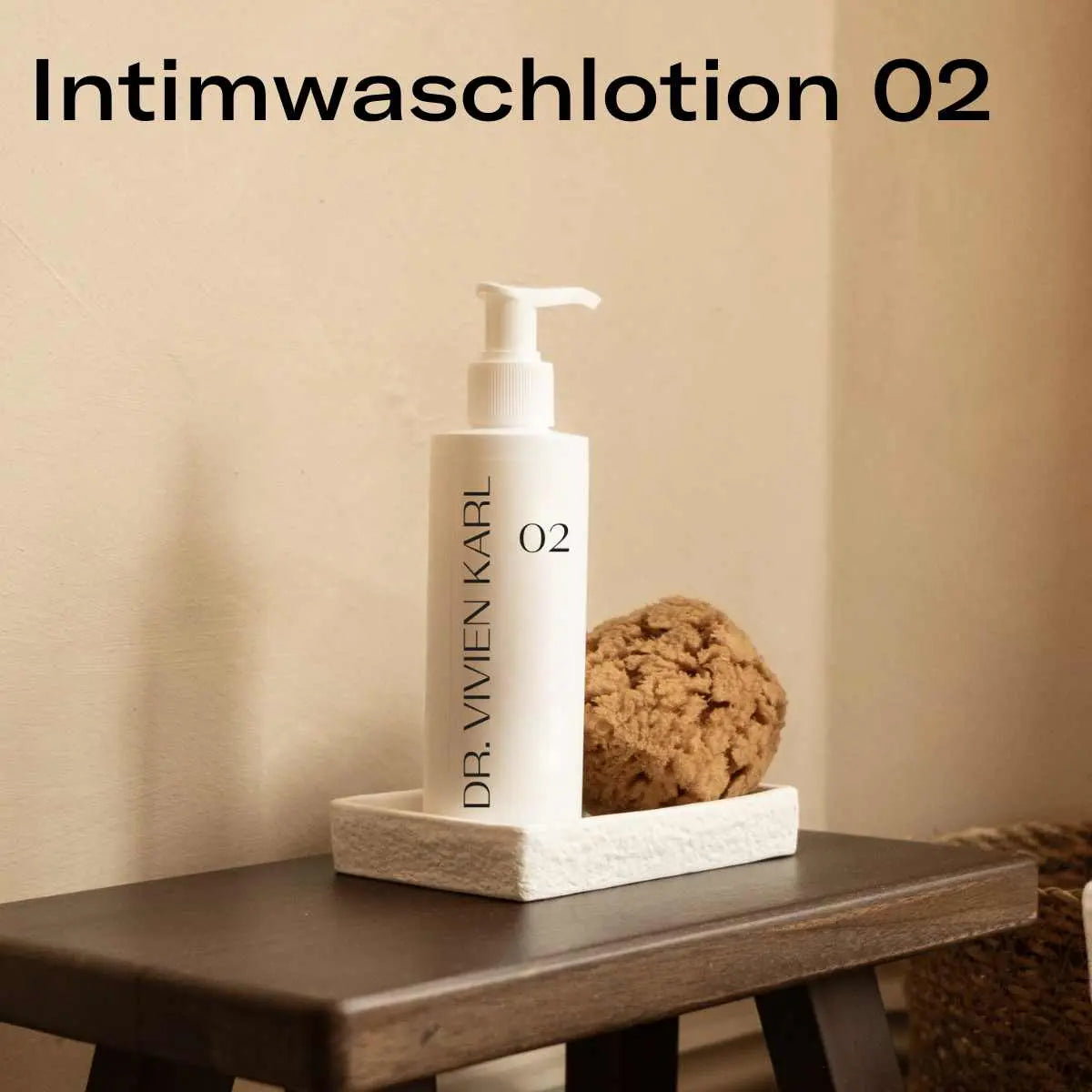„Das da unten“, Mumu, Perle: Für den weiblichen Intimbereich und seine Bestandteile gibt es zahlreiche Bezeichnungen. Wie sie richtig genannt werden und was ihre Aufgabe ist, haben wir in unserem umfassenden Lexikon zusammengestellt. Schon mal was von der Bartholin-Drüse gehört?
Wer guten Sex haben möchte, muss über seine Bedürfnisse sprechen können. Wer sich wohlfühlen möchte, muss benennen können, wo es zwickt. Und wer gesundheitliche Beschwerden behandeln lassen möchte, muss sagen, was wehtut. Doch wie sollen wir über etwas sprechen, dessen Namen wir nicht kennen?
Die weibliche Anatomie ist ein komplexes Thema. Und das auch für viele Frauen! Denn viele Frauen kennen den Unterschied zwischen Vagina und Vulva nicht. Aber keine Sorge, wir klären auf, und zwar so, dass du es wirklich verstehst. Und wer jetzt denkt: „Ich weiß schon alles!“ Quizfrage: Wofür sorgt die Bartholin-Drüse und was ist das Klimakterium?
Die Antwort darauf und alles, was du über den Aufbau des weiblichen Intimbereichs und die Funktionen der einzelnen Organe sowie Körperteile wissen musst, erfährst du in unserem Anatomie-Lexikon von A bis Z.
BARTHOLIN-DRÜSE ODER GROSSE VORHOFDRÜSE
Mit einer Länge von einem halben Zentimeter gehört sie zu den kleinen Organen im weiblichen Intimbereich. Die Bartholin-Drüse ist ein traubenförmiges inneres Geschlechtsorgan und kommt im Doppelpack. Links und rechts an der unteren Vaginalöffnung sorgen die Drüsen dafür, dass es beim Sex flutscht. Bei Erregung sondern die Bartholin-Drüsen nämlich ein grau-weißes Sekret ab, das Vagina und Vulva befeuchtet und als natürliches Gleitmittel dient. Für schmerzfreien Geschlechtsverkehr sind die Batholin-Drüsen, auch als große Vorhofdrüsen bekannt, besonders wichtig.

EILEITER
Sie verbinden die Eierstöcke mit der Gebärmutter und transportieren das Ei nach dem Eisprung vom einen, zum anderen: die Eileiter. Im Inneren sind die dünnen Röhren mit Zilien ausgekleidet. Die haarähnlichen Fortsätze helfen dabei, das Ei durch die Eileiter zu bewegen. Dort findet normalerweise auch die Befruchtung der Eizelle durch Spermien statt.
EIERSTÖCKE
Links uns rechts neben der Gebärmutter befinden sich die Eierstöcke. Die kleinen Organe sind für die Produktion und die Freisetzung der Eizelle während des Eisprungs verantwortlich. Neben dieser wichtigen Aufgabe übernehmen sie noch eine weitere: Sie produzieren Hormone wie Östrogen und Progesteron, die den Menstruationszyklus regulieren und eine Schwangerschaft unterstützen.
GEBÄRMUTTER ODER UTERUS
Mit ihrer Form erinnert die Gebärmutter an eine Birne. Das innere Geschlechtsorgan liegt zwischen der Blase und dem Enddarm und besteht vor allem aus Muskeln. Die Gebärmutter setzt sich aus dem Gebärmutterkörper und dem Gebärmutterhals zusammen und ist bei erwachsenen Frauen circa sieben bis zehn Zentimeter lang. Während der Schwangerschaft wächst in ihr der Fötus heran. Bei der Geburt spielt die Gebärmutter eine wichtige Rolle, da sie durch Muskelkontraktionen (Wehen) die Geburt einleitet und das Baby aus dem Körper drückt. Auch während der Periode zieht sich die Muskulatur der Gebärmutter zusammen, um die Schleimhaut zu lösen. Bei vielen Frauen äußert sich der Prozess durch Periodenkrämpfe und Schmerzen im Unterleib.

KLITORIS
Perle, Klitzler, Lusterbse: In der Umgangssprache hat die Klitoris viele Namen. Für die Sexualität spielt sie eine wichtige Rolle. Denn die Klitoris ist ein sehr empfindlicher Teil der Vulva. Von außen ist nur ein kleiner Teil von ihr sichtbar: Die Klitoriseichel und die Klitorisvorhaut. Der größte Teil von ihr, die Klitorisschenkel und ihre Schwellkörper liegen jedoch im Inneren versteckt. Mit mehreren Tausend Nervenenden gehört sie zum empfindlichsten Teil des Körpers und ist für sexuelle Erregung und den Orgasmus essenziell. Lange wurde zwischen vaginalem und klitoralem Orgasmus unterschieden. Inzwischen weiß man aber, dass jeder Orgasmus ein Zusammenspiel von Organen und Nerven ist. Denn der versteckte Teil der Klitoris wird auch bei penetrativem Sex stimuliert.
MILCHSÄUREBAKTERIEN ODER LAKTOBAZILLEN
Milchsäurebakterien, insbesondere Laktobazillen, spielen eine wichtige Rolle im weiblichen Intimbereich. Sie sind natürliche Bewohner der Vagina und tragen zur Aufrechterhaltung eines gesunden vaginalen Mikrobioms bei. Laktobazillen produzieren Milchsäure, wodurch ein saures Milieu entsteht. Ein niedriger pH-Wert verhindert das Wachstum schädlicher Bakterien, Pilze und Viren. Darum hilft es auch, die natürliche Schutzbarriere der Vagina aufrechtzuerhalten und Infektionen vorzubeugen. Ein gesundes Gleichgewicht der Milchsäurebakterien trägt zur Vorbeugung von vaginalen Infektionen wie bakterieller Vaginose und Hefepilzinfektionen bei. Wenn jedoch das Gleichgewicht gestört ist, beispielsweise durch Antibiotika, hormonelle Veränderungen oder andere Faktoren, kann sich die Anzahl der Laktobazillen verringern, was zu einem Anstieg schädlicher Organismen führen kann. Um die Gesundheit des eigenen Intimbereichs zu fördern, ist es wichtig, das natürliche Mikrobiom zu unterstützen.
MENSTRUATION
Ok, erwischt! Die Menstruation ist natürlich kein Organ oder Körperteil. Aber wir mogeln sie trotzdem in unser A bis Z. Denn sie ist ein entscheidender Bestandteil der weiblichen Gesundheit und betrifft ziemlich viele der Organe da unten. Die Menstruation, auch Periode, Tage oder Monatsblutung genannt, tritt bei Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter auf. Die meisten erleben sie mit 12 oder 13 Jahren das erste und mit Anfang 50 das letzte Mal. Wenn sich während des Zyklus keine befruchtete Eizelle in die Gebärmutterschleimhaut eingenistet hat, löst sich die Schleimhaut jeden Monat ab und fließt mitsamt Blut aus der Vagina. Dieser Prozess heißt Menstruation und dauert meist zwischen drei und sieben Tage.
MENOPAUSE
Wer Menstruation sagt, muss auch Menopause sagen. Auch die Menopause ist kein Organ und das letzte Thema, das wir in diesen Artikel schmuggeln – versprochen. Wir können nur keine Chance ungenutzt lassen, um über die Menopause zu sprechen. Aber wir halten uns kurz und knapp: Die Menopause beschreibt den Zeitpunkt der letzten Monatsblutung und damit das Ende der fruchtbaren Lebensphase. Ihr voraus geht eine lange Phase der hormonellen Umstellung. Sie wird umgangssprachlich als Wechseljahre bezeichnet und heißt medizinisch Klimakterium. Dabei sinkt der Östrogenspiegel, wodurch der Zyklus unregelmäßiger wird und schließlich ganz ausbleibt. Wann die Menopause eintritt, ist von Frau zu Frau unterschiedlich – im Durchschnitt mit 51 oder 52 Jahren.

VAGINA ODER SCHEIDE
Sie verbindet die Gebärmutter mit der Außenwelt: die Vagina. Der Muskelschlauch ist ein sehr dehnbares Organ und für allerhand Dinge gut. Mit der Vagina können Frauen zum Beispiel sexuelle Stimulation erleben und Kinder gebären. So kommt der Großteil der Menschen durch die Vagina auf die Welt. Aber auch abgesehen vom Kinderkriegen und Sex ist die Vagina ein faszinierendes Organ. Denn sie beherbergt eine Vielzahl von Bakterien, darunter auch Milchsäurebakterien, die für ein saures Milieu sorgen. Dadurch kann die Vagina sich selbst reinigen! Mit 3,8 bis 4,5 ist der pH-Wert der Vagina deshalb auch ein anderer als der pH-Wert der restlichen Haut. Früher hieß die Vagina vor allem Scheide. Dagegen sprechen sich jedoch immer mehr Frauen aus, weil die Scheide eine Aufbewahrung fürs Schwert meint. Und die Vagina nun mal nicht nur zur Penetration gut ist. Der lateinische Begriff Vagina ist übrigens nur die Übersetzung von Scheide. Da jedoch niemand Latein spricht, wird der Begriff als neutraler wahrgenommen.
VULVA
Vulva ist ein Oberbegriff für die äußeren Geschlechtsorgane. Dazu gehören die Klitoris, der Vaginavorhof und die Vulvalippen. Wenn wir den äußeren Intimbereich meinen oder das „Untenrum“, sprechen wir also von der Vulva. Der Begriff meint jedoch nicht das gesamte weibliche Geschlechtsorgan. Übrigens ist Vulva der lateinische Begriff für die weibliche Scham.
VULVALIPPEN
Früher Schamlippen, heute Vulvalippen! Die Hautfalten, die die Klitoris und den Eingang der Vagina umgeben, sind zum Schutz der empfindlichen Körperzone da. Es gibt innere und äußere Vulvalippen, die bei jeder Frau unterschiedlich lang sind und ganz individuell aussehen. Bei sexueller Erregung schwellen sie an und werden empfindlicher. Lange war der Begriff Schamlippen geläufig. Jedoch sprechen sich immer mehr Frauen dagegen aus, ihren intimsten Teil des Körpers und einen wichtigen Part ihrer Sexualität mit Scham zu verbinden. Deshalb hat sich inzwischen das Wort Vulvalippen etabliert.